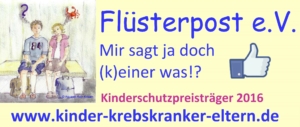„Café Krebs“ – am Tisch mit Franziska Ivens
Dies ist ein Veranstaltungsinhalt von SURVIVORS HOME am 13.06.2025.
Ein persönliches Gespräch über Krankheitserfahrung, Digitalisierung und Zukunftsperspektiven im Gesundheitswesen
Vom Systemprofi zur Patientin
Franziska Ivens ist als Digitalexpertin im Gesundheitswesen tätig, unter anderem am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut. Sie bringt 15 Jahre Berufserfahrung in der Schnittstelle von Technologie, KI und Gesundheit mit. Die Diagnose Brustkrebs trifft sie dennoch unvorbereitet – und offenbart eine gravierende Fehldiagnose: Ihre Beschwerden werden zunächst über Monate hinweg verharmlost. Erst der Austausch mit einer Freundin bringt den Wendepunkt. Ein bildgebendes Verfahren bestätigt schließlich den Verdacht.
Der Wechsel der Perspektive
Die Erfahrung als Patientin verändert Ivens grundlegend. Sie spricht von einem „Seitenwechsel“: Vom beruflichen Blick auf das System hin zur unmittelbaren Betroffenheit. Sie beschreibt ihre Krankheit als schweren, aber auch lehrreichen Einschnitt, der sie motiviert, ihre Kompetenzen gezielt für eine menschlichere und effizientere Versorgung einzusetzen.
Offenheit als Teil der Entstigmatisierung
Ivens macht sich stark für eine offenere gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Krebserkrankungen. Sie schildert, wie schwierig es im privaten Umfeld ist, über die Diagnose zu sprechen, und plädiert dafür, das Thema aus der Tabuzone zu holen. Ihre eigene Krankheitsgeschichte zeigt, dass auch junge Menschen betroffen sein können – und dass Vorsorge und Zweitmeinungen lebensrettend sein können.
Positives Beispiel: Unterstützung durch den Arbeitgeber
Kurz vor dem Beginn eines neuen Jobs erhält Ivens die Diagnose. Trotz ihrer Befürchtungen erlebt sie große Unterstützung durch ihren Arbeitgeber im Bereich Mental Health. Flexible Arbeitszeiten, ein Notfallcode für Rückzugsmomente und ein verständnisvolles Umfeld ermöglichen es ihr, während der Therapie weiterzuarbeiten. Sie appelliert an Unternehmen, ähnliche Unterstützungsstrukturen zu schaffen.
Fehler im System: Zeitmangel und Fehldiagnosen
Ivens benennt strukturelle Schwächen im Gesundheitssystem: Bei der Diagnosestellung stehen Ärzten oft nur wenige Minuten zur Verfügung. Patienten sind in Schocksituationen häufig nicht aufnahmefähig. Fehlende bildgebende Verfahren und veraltete Routinen können gravierende Folgen haben – wie ihr eigener Fall zeigt.
Wie KI und Digitalisierung helfen können
Ivens schildert konkrete Anwendungen, die heute bereits existieren oder sich in Entwicklung befinden:
- Künstliche Intelligenz in der Diagnostik: KI kann bildgebende Verfahren auswerten, Behandlungsverläufe analysieren und frühzeitig Anomalien erkennen.
- Digitale Zwillinge: Mathematische Modelle, die personalisierte Therapien und Medikamentenwirkungen simulieren.
- Virtuelle Assistenten (AI Agents): Digitale Begleiter, die Patienten durch den Behandlungsalltag führen und Informationen bereitstellen.
- VR/AR im OP: Virtuelle Anwendungen, die OPs unterstützen, Blutfluss kontrollieren oder den Geräteeinsatz dokumentieren.
- Datenbasierte Prävention: Wearables und Smartwatches ermöglichen Frühwarnsysteme, etwa bei herznahen Bestrahlungen oder Bewegungsdaten.
Hürden der Innovation: Datenschutz und Bürokratie
Trotz technologischer Fortschritte sieht Ivens große Herausforderungen in Deutschland. Datenschutz und Regularien erschweren die Integration neuer Anwendungen. Gleichzeitig mangelt es an standardisierten Datensätzen und der Bereitschaft, patientenzentriert zu denken. Sie fordert eine neue Balance zwischen Datenschutz und Innovationsförderung.
Einsatz für mehr Studienbeteiligung
Ivens betont die Bedeutung klinischer Studien für den medizinischen Fortschritt. In Deutschland sind die Teilnahmezahlen vergleichsweise niedrig. Sie sieht großes Potenzial in KI-basierten Matching-Systemen, die Patienten gezielt passende Studien vorschlagen – vorausgesetzt, die Datenbasis stimmt.
Nutzung digitaler Helfer im Alltag
Ivens selbst nutzt eine Vielzahl digitaler Tools, darunter Smartwatches zur Überwachung von Vitalwerten, Apps zur Kommunikation mit anderen Patienten sowie Lebensqualitätsabfragen, die aktiv in ihre Behandlung einfließen. Sie bedauert, dass behandelnde Ärzte bislang kaum Interesse an diesen Daten zeigen.
Elektronische Patientenakte: Plädoyer für breitere Nutzung
Sie befürwortet die elektronische Patientenakte (EPA) ausdrücklich – aus persönlichem Interesse wie auch aus Gemeinwohlperspektive. Die EPA erleichtert Behandlungsabläufe, vermeidet Informationsverluste und kann bei Freigabe auch für Forschungszwecke genutzt werden. Ivens spricht sich klar für das Opt-out-Modell aus.
Der Blick in die Zukunft: Prävention und Personalisierung
Ivens sieht großes Potenzial in der personalisierten Prävention. Individuelle Risikofaktoren – etwa genetische Dispositionen oder biochemische Marker – könnten künftig durch KI besser ausgewertet und in Empfehlungen übersetzt werden. Statt allgemeiner Gesundheitsratschläge wünscht sie sich maßgeschneiderte Empfehlungen, die auf individuelle Bedarfe eingehen.
Wunschbild: Der persönliche Gesundheitsnavigator
Ihr Zukunftstraum: ein digitaler Assistent, der Patienten durch das komplexe Versorgungssystem navigiert – vergleichbar mit Google Maps. Der „AI Agent“ soll Diagnosen verständlich erklären, Behandlungsoptionen aufzeigen und emotionale wie organisatorische Unterstützung leisten.
Franziska Ivens verbindet persönliche Betroffenheit mit fachlicher Kompetenz und bringt eine klare Vision mit: Sie möchte ein Gesundheitssystem mitgestalten, das digital fortschrittlich, menschlich und zugänglich ist. Ihre Erfahrung zeigt, wie wichtig es ist, Technik nicht als Ersatz, sondern als Chance für mehr Menschlichkeit zu verstehen – und Patienten eine aktivere Rolle in der Gestaltung ihrer Versorgung zu ermöglichen.
- coronavirus Gebärmutterkrebs
-
Mehr erfahren: